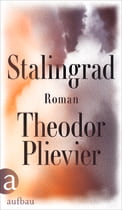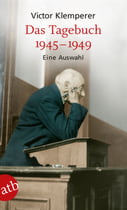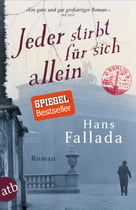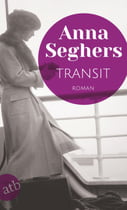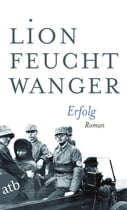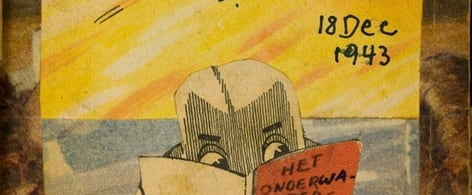80 Jahre Kriegsende, 80 Jahre Bücher für den Frieden
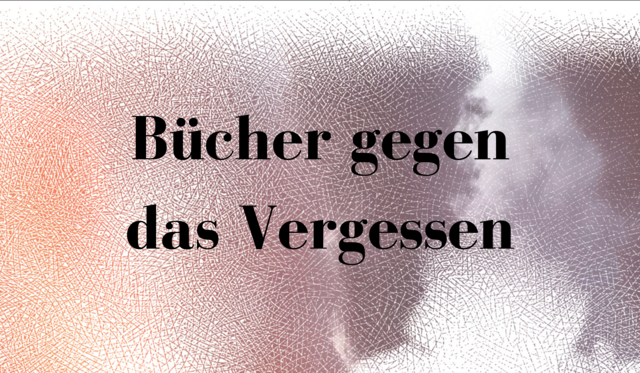
Der Literaturwissenschaftler Carsten Gansel erzählt, wie Theodor Plieviers Roman sofort zum Weltbestseller wurde und warum wir jetzt, 80 Jahre nach Erscheinen, die Neuausgabe dringend wieder lesen sollten.
Auszug aus dem Nachwort der ERWEITERTEN NEUAUSGABE des Bestsellers von 1945
Der erste Bestseller im Nachkriegsdeutschland
Theodor Plieviers »Stalingrad« war eines der ersten Bücher, die im Nachkriegsdeutschland erschienen. Gedruckt wurde es im Aufbau-Verlag, den der Journalist Heinz Willmann, der Volkswirt der Verlagsbuchhändler Kurt Wilhelm und der Verlagskaufmann Otto Schiele am 16. August 1945 in der Wohnung von Schiele in Berlin-Dahlem gerade erst gegründet hatten. Die Lizensierung durch die Sowjetische Besatzungsmacht erfolgte prompt, und Mitte September fand der Verlag, als dessen »geistiger Gründungsvater« Johannes R. Becher gilt, seinen Sitz in der traditionsreichen Französischen Straße 32 unweit des Berliner Gendarmenmarkts.
»Es gibt Bücher, die gelesen werden müssen!« Kurt W. Marek
Stalingrad
...
Roman
Dass Plieviers Roman zum Schlüsseltext bei der Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg werden konnte, hat viele Gründe. Liest man heute die Rezensionen, die nach dem Erscheinen geschrieben wurden, dann zeigt sich, in welchem Maße Plieviers Text stellvertretend für den gesamten Verlauf des Krieges (vor allem an der Ostfront) angesehen wurde und in der Folgezeit Deutungshoheit erlangte. In Verbindung damit erschien die Kesselschlacht, die für den Zweiten Weltkrieg nicht kennzeichnend war, geradezu als Symbol für das deutsche Schicksal und bot durch den minutiös beschriebenen Untergang einer ganzen Armee ein Identifikationsangebot für die Kriegsgeneration. Schließlich war es die Mischung aus dokumentarisch belegten Fakten und dichterischer Freiheit, die von der jungen Autorengeneration, wie sie sich um die Gruppe 47 etablierte, als maßstabsetzend angesehen wurde. Die euphorischen Bewertungen reichten von Wolfgang Borchert über Alfred Andersch und Johannes R. Becher bis Stephan Hermlin und vielen mehr. Was Plievier »die Feder führte«? Die Intention des Buches umriss er so:
»Als ein Teil dieses fluchbeladenen und schauerlich sühnenden Volkes habe ich die Schlachtfelder gesehen, habe ich die aus den Trümmern gelesenen armen Aufzeichnungen in Briefen und Tagebüchern in den Händen gehalten, habe mit gefangenen Soldaten und Offizieren gesprochen und, immer um das Selbstmörderische jenes wahnwitzigen Raubkrieges wissend, habe ich unternommen, das Geschehen an der Wolga nicht nur als den militärischen, auch als moralischen Wendepunkt in der Geschichte unseres Volkes zu gestalten.«
100 Seiten umfangreicher – die vorliegende Fassung »letzter Hand«
Es gibt eine Reihe von Gründen, Plieviers Fassung »letzter Hand« zu folgen. Die Buchausgabe ist im Vergleich zum Zeitungsdruck rund 100 Seiten umfangreicher. Was hat Plievier korrigiert und ergänzt? In aller Kürze: Er hat den Roman für die Buchausgabe literarisch überarbeitet, grundlegende Korrekturen vorgenommen, was das Faktische angeht, wobei besonders deutlich die Veränderungen im Kontext mit Verbrechen der Wehrmacht sind: Plievier tilgt Wertungen und zieht sich stattdessen auf die Position eines Chronisten zurück, der die Fakten benennt.
Will man ein differenziertes Bild dessen gewinnen, was in Stalingrad geschah, und Theodor Plieviers dokumentarischer wie literarischer Leistung gerecht werden, dann sollte man zu der autorisierten Fassung »letzter Hand« greifen.
»Dieses Buch wird zu den dauernden klassischen Werken zählen.« Victor Klemperer
Carsten Gansel, geboren 1955, ist seit 1995 Professor für Neuere Deutsche Literatur. Als Autor und Herausgeber verantwortete er u. a. die Neuausgabe von Heinrich Gerlachs »Durchbruch bei Stalingrad« (2016), die international für Aufsehen sorgte. Zuletzt erschien seine Brigitte-Reimann-Biographie »Ich bin so gierig nach Leben« (2023), die auf der Spiegel-Bestsellerliste stand.