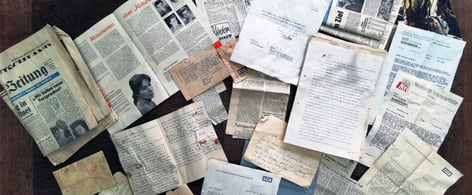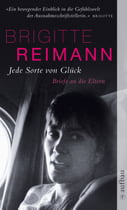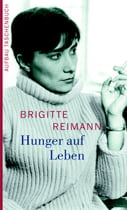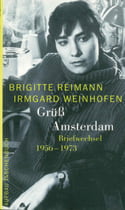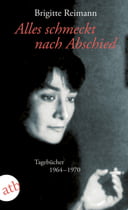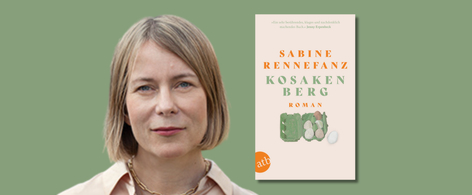»Man muss das bisschen Wärme festhalten, das noch geblieben ist«

Wie steht ein Mensch aus Trümmern auf? Das ist eine, wenn nicht sogar die zentrale Frage im Leben von Brigitte Reimann. In ihrem Fall lautet die Antwort: mit Literatur.
Die Frau am Pranger
Roman
Aus dem Vorwort von Carolin Würfel
»Die Frau am Pranger« – jenes feine Buch, erschienen 1956 im Verlag Neues Leben – war Reimanns Debüt, ihr Eintritt in die Welt der Literatur. Darin erzählt sie die verbotene Liebesgeschichte zwischen der deutschen Bäuerin Kathrin Marten und dem aus der Ukraine stammenden Kriegsgefangenen Alexej Iwanowitsch Lunjew während des Zweiten Weltkriegs. Romeo und Julia auf nationalsozialistischem Boden, könnte man sagen.
Brigitte Reimann ging jedoch einen Schritt weiter. Ihre Erzählung wagte etwas Unerhörtes, sie brach im Nachkriegsdeutschland Tabus, die noch gefährlicher waren als die ohnehin schon skandalöse Liebe zwischen einer Deutschen und dem Kriegsfeind: Reimann hinterfragte die Mechanismen von Schuld und Verdrängung und die vermeintlich unerschütterlichen Rollen von Tätern und Opfern. Sie war 22 Jahre alt, als sie das Buch schrieb. Eine junge ostdeutsche Frau, die nichts Geringeres wollte, als mit Sprache eine neue, bessere Zukunft an den Horizont zu zeichnen. Und wer wünscht sich keine bessere Zukunft, damals wie heute?
»Die Frau am Pranger« machte Brigitte Reimann, geboren 1933 in Burg bei Magdeburg, schlagartig berühmt. Was die wenigsten wissen: Der Ursprung des Romans, der Anfang dieser Erfolgsgeschichte, liegt weit zurück, im Winter 1947/48. In diesem Winter, zwei Jahre nach Kriegsende, erkrankte sie, damals vierzehn Jahre alt, an spinaler Kinderlähmung. Während sich die Welt von den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs erholte und von Trümmern befreite, wurde ihr eigener Körper plötzlich zum Krisengebiet, er versagte ihr den Dienst. Wochenlang lag sie allein in einem Krankenzimmer, zeitweise bis zum Hals vollständig gelähmt. Was tut man als Mädchen in einer solchen Situation? Brigitte Reimann las. Sie las gegen die Einsamkeit, aber auch für ein Gefühl von Teilhabe an dieser Welt. Sie las, um all das Grauen, das geschehen war, zu verstehen und um die Hoffnung nicht aufzugeben. Die Hoffnung, dass sie wieder gesund werden würde, genau wie diese Welt. Wenn selbst jemand wie ihr großes Vorbild Anna Seghers aus Mexiko nach Deutschland zurückkehren und wieder an dieses Land und seine Bürgerinnen und Bürger glauben konnte, würde auch sie das tun. Schon allein um ihrer selbst willen. Und es war ebenjene Hoffnung der Vierzehnjährigen, die sie einige Jahre später in der »Frau am Pranger« ausformulierte. »Eines Tages«, heißt es in dem Buch, »wird es kein Elend mehr geben, keine Feindschaft und keinen Hass. Die Menschen werden in Frieden leben, jeder wird satt sein und glücklich. Wir dürfen wieder träumen, Kathrin …«
Es geht in »Die Frau am Pranger« aber nicht nur um die Liebe zu einem, den man nicht lieben darf. Es geht in dem Buch auch um Unterdrückung, vor allem die Unterdrückung von Frauen, und auch das macht diese Geschichte hochaktuell. Der weibliche Körper als ewiges Krisengebiet, das oft übersehen und gleichzeitig so oft benutzt wird, um Dominanz und Macht zur Schau zu stellen. Eine Frau wie Kathrin, sie steht zu keinem Zeitpunkt an der Front, aber muss trotzdem jeden Moment um Leib und Leben fürchten. Das war im Zweiten Weltkrieg so. Das ist teilweise bis heute so. Gewalt ist für Frauen Alltag. Gewalt zu Hause, Gewalt auf der Straße, Gewalt im Krieg. Für Männer ist der Kampf an der Front ein Ausnahmezustand. Für Frauen fängt die Bedrohung schon beim Gang durchs Dorf an. Und das hört wohl erst auf, wenn Kriege, wenn das Patriarchat enden und wenn Frauen aufbegehren. So wie Kathrin Marten es tut. Sie wächst im Verlauf der Geschichte über sich hinaus, entwickelt ungeahnte Kräfte und unbändigen Willen. Sie kämpft ums Überleben. Sie stellt sich gegen die Unmenschlichkeit. Und sie realisiert, dass man Frauen wie sie jahrelang kleingehalten hat, dass sie mehr wert ist, dass man sie nicht weiter »verschachern« darf für ein bisschen mehr Land, ein bisschen mehr Befriedigung im Bett oder ein bisschen mehr Macht. Wie viel das immer noch mit weiblichem Leben und weiblicher Existenz im 21. Jahrhundert zu tun hat, muss man niemandem erklären.