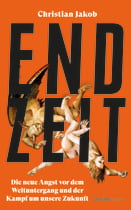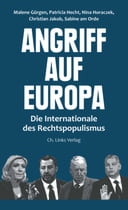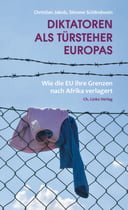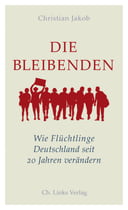»Die Zukunft nur als dystopischen Rest einer einzig lebenswerten Gegenwart zu sehen, ist eine schrecklich fantasielose Vorstellung«
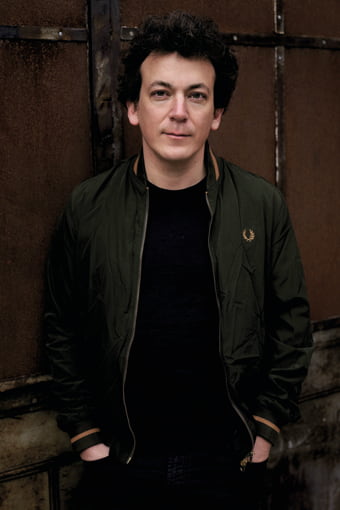
Das Buch erscheint am 19. September 2023
Die Angst vor dem Ende der Welt – das ist ein Thema, das sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte zieht und auch schon vor Jahren den Stoff für dystopische Filme, Serien und Bücher lieferte. Was hat Sie veranlasst, gerade jetzt ein Buch über dieses Phänomen zu schreiben?
Endzeit
...
Die neue Angst vor dem Weltuntergang und der Kampf um unsere Zukunft
Die Angst ist in der Tat eine Konstante der menschlichen Geschichte. In den letzten Jahren ist jedoch einiges geschehen, was diesem alten Bild neuen Auftrieb verliehen hat. Nicht alles, aber vieles davon steht im Zusammenhang mit der Klimakrise. 2021 wurden für eine Studie weltweit 10.000 Menschen unter 25 Jahren befragt. 56 Prozent von ihnen glaubten, dass die Menschheit dem Untergang geweiht sei. Die Bereitschaft, voneinander unabhängige oder nur teilweise miteinander verbundene Krisen zu einem umfassenden zivilisatorischen Rutschen zusammenzudenken, ist heute groß. Eine gute Zukunft erscheint immer mehr Menschen nicht vorstellbar. Und mit dem Glauben an ein mögliches besseres Morgen zerrinnt die Fähigkeit, es zu erkämpfen und zu gestalten.
Warum, glauben Sie, ist diese Angst gerade bei der jungen Generation seit einiger Zeit so ausgeprägt?
Da kommt einiges zusammen: Eine Ballung objektiv bedrohlicher Krisen, die zunehmend konkret spürbar werden. Zu düsteren ökologischen Szenarien treten politische und ökonomische Krisen, drohender Wohlstandsverlust. Dazu kommt aber ein völlig neues Mediensystem: Journalistische und Soziale Medien, die in Konkurrenz zueinander und wechselseitiger Befeuerung dramatische Nachrichten noch dramatischer zeichnen und verbreiten. Heute können Menschen in einer historisch völlig neuen Weise über ihre Timeline selbst entscheiden, was sie lesen und über die Welt – und immer mehr suchen so immer neue Bestätigung für ihre Untergangserwartungen. Dieser Mechanismus verkoppelt sich mit der Tatsache, dass der Mensch negative Nachrichten besonders stark wahrnimmt, auf diese reagiert und sie sich speichert.
In Ihrem Buch analysieren Sie die verschiedensten Gruppierungen, die sich mit der Endzeit auseinandersetzen. Was haben sie alle gemeinsam?
Wenig bis nichts. Der Klimabewegung wird vielfach Apokalyptik vorgeworfen. Ich finde das unzutreffend. Ihr Protest beweist ja, dass sie an die Möglichkeit glauben, Verbesserungen herbeiführen zu können. Die Psychoanalyse zeigt interessante Mechanismen beim Umgang mit Untergangserwartungen: Schuld, Abwehr und Affirmation. Viele ertragen den Gedanken an das, was die Gesellschaft, der sie angehören, angerichtet hat, nicht. Sie wehren Schuldgefühle ab und richten Aggressionen auf jene, die das erschweren – etwa die Klimabewegung. Oder sie affirmieren den Untergang nach dem Motto: »Ist besser so für den Planeten« oder »Das haben wir verdient.« Rechte wiederum beschwören heute den Untergang allenthalben. Sie sehen darin ihr Ticket an die Macht und warnen ohne Unterlass vor Blackouts, Wirtschaftscrashs oder dem Aussterben der Weißen. Dabei verbreiten sie Verschwörungstheorien, die verfangen, weil vielen Menschen der Gedanke, hinter den vielen Krisen stecke etwas Allgemeines, Größeres, trügerische Erleichterung bietet.
Sie schreiben auch über Ihre Sorge, dass die Angst insbesondere die junge Generation in ihrem Handeln lähmen könnte. Wie können wir ihnen und uns, angesichts all der Krisen auf der Welt, wieder Hoffnung geben?
Während des größten Teils der Menschheitsgeschichte starben 47 Prozent der Menschen vor der Pubertät, vor 1800 hat die durchschnittliche Lebenserwartung nirgendwo auf der Welt über 40 Jahre betragen, heute sind es im weltweiten Durchschnitt 73 Jahre. Was heute als extreme Armut gilt, war lange der Normalzustand. War die Welt praktisch während der gesamten Menschheitsgeschichte so schlecht gewesen, dass unsere Vorfahren uns das Leben nicht hätten ermöglichen dürfen?
Die heutige Generation ist nicht die erste, die Krisen von überwältigender Dramatik erlebt und glaubt, keine Zukunft zu haben. Nicht nur im 20. Jahrhundert ging es schon anderen so. Wirklich neu sind aber ihre Möglichkeiten, sich in noch nicht gekannter Weise zu vernetzen – und so Einfluss auf die Zukunft zu nehmen.
Niemand weiß, an was sich Menschen gewöhnen, wie sie Glück definieren, wie ein erfülltes Leben, ein lebenswerter Alltag für sie aussehen werden. Die Zukunft nur als dystopischen Rest einer einzig lebenswerten Gegenwart zu sehen, ist eine schrecklich fantasielose Vorstellung. Keine Generation der Moderne hat ihren Kindern eine Welt hinterlassen, die sich nicht »dramatisch« von ihrer eigenen unterschieden hätte. Und je mehr sich Menschen mit der Vergangenheit beschäftigen, desto klarer wird ihnen meist, dass sie diese kaum gegen ihre eigene Zeit tauschen würden.