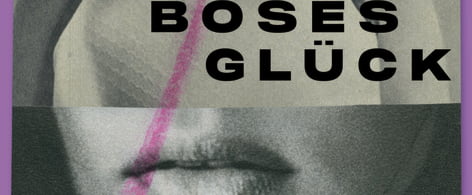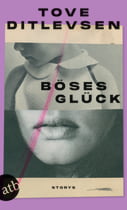»Ich möchte jetzt nur erzählen, wozu ich Lust habe«

Vilhelms Zimmer
...
Roman
Aus dem Nachwort der Übersetzerin Ursel Allenstein
»Mein einziger, leidenschaftlicher Wunsch besteht darin, das Buch meines Lebens über dich und mich zu schreiben, nicht als Racheakt, sondern einfach nur als Geschichte über eine große Liebe und deren Scheitern. (...) Zeig diesen Brief niemandem, denn kein Mensch wird unsere wahnsinnige Beziehung verstehen, ehe ich mich zusammenreiße und einen künstlerischen Ausdruck dafür finde«, schrieb Tove Ditlevsen am 27. September 1972 an ihren Ex-Mann Victor Andreasen.
Das Buch ihres Lebens, der letzte Roman, ist »Vilhelms Zimmer«. Das kurze Zitat aus dem Brief bringt auch Tove Ditlevsens Poetologie auf den Punkt: Das Persönliche in eine literarische Form zu bringen, die es allgemein erfahrbar macht.
Die ersten feinen, aber unwiderruflichen Risse zwischen Lise und Vilhelm, ihre Leidenschaft (und Leidensfähigkeit), ihre bösartigen gegenseitigen Schikanen, die sich irgendwann ins Unerträgliche steigern und katastrophal enden – all das verdichtet Tove Ditlevsen zu schmerzlich klaren Szenen einer Ehe. Wie durch ein Brennglas betrachten wir auch den Männertypus des »charmanten Psychopathen«, der trotz seines misogynen »Folterrepertoires« in seiner ganzen Eitelkeit und Erbärmlichkeit entlarvt wird.

Obwohl man Tove Ditlevsen bisweilen vorwarf, sich nicht genug für Frauenrechte zu interessieren, zeigt sich in »Vilhelms Zimmer« einmal mehr, wie präzise sie verschiedene Formen männlicher Tyrannei beobachten und beschreiben konnte. Fast alle der im Roman versammelten Ehefrauen, Geliebten, Hausangestellten und Prostituierten leben in einer fatalen Abhängigkeit. Neben dem ständigen Psychoterror leiden sie unter unfreiwilligen Schwangerschaften, versuchten Vergewaltigungen und körperlicher Gewalt. Doch nicht nur Lise, die ohnehin nur schwer bezähmbar ist, sondern auch ihre hingebungsvoll-häusliche Gegenspielerin Mille, emanzipieren sich vom Narzissten Vilhelm, als dieser den Bogen überspannt. (...) Am Ende hat sich das Machtverhältnis umgekehrt. Lises letzter großer Triumph besteht darin, genau in dem Moment endgültig von der Bühne des Lebens abzutreten, als der Ex-Mann noch einmal den großen Retter spielen und für immer zu ihr zurückkehren will.
Gesichter
...
Roman
Nicht nur aufgrund der autobiographisch gefärbten Figur der Lise Mundus könnte man »Vilhelms Zimmer« als unabhängige Fortsetzung von »Gesichter« (1968) betrachten. Beide sind mit der Genrebezeichnung »Roman« versehen und formal wie sprachlich experimenteller als die 1971 erschienenen »Erinnerungen« »Abhängigkeit«, an deren Ende der monströse Victor noch als rettender Engel auftaucht, obwohl die Ehe zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits ein für alle Mal gescheitert war.
An »Gesichter« erinnern auch die Psychiatrieumgebung und die vielen surrealen Szenen, die teils wahnhaft wirken, teils auch die Gattung des Schauer- und Detektivromans parodieren. Vor allem aber treibt Tove Ditlevsen in ihrem letzten Roman ein ständiges Spiel mit der Metafiktion. Sie verarbeitet fiktive und tatsächlich erschienene Texte und Zeitungsbeiträge und nicht näher zu bestimmende Briefe an und Tagebuchauszüge von Vilhelm (oder womöglich auch Victor).
Es scheint, als wolle Tove Ditlevsen es im Buch ihres Lebens mit ihren inneren und äußeren Angstgegnern aufnehmen.
Abgesehen von der Hauptfigur Lise Mundus gibt es eine weitere allwissende Instanz, eine übermächtige Ich-Erzählerin, die ihre Figuren wie eine Marionettenspielerin ins Unglück lenkt und manchmal mitten im Satz zwischen sich und Lise hin- und herwechselt (...) Diese Don-Quijote-artige Ich-Erzählerin, die Lises Tod überlebt hat, aber nur schwer von ihr zu trennen ist, schwebt oft mit einer abgeklärten Distanz über dem Geschehen und scheint zugleich schonungslos mit Tove Ditlevsen selbst verbunden. (...) »Diese Frau muss ich mit einer neuen Sprache beschenken, nach deren Kühnheit Vilhelm nicht mehr vergebens suchen würde«, sagt die Ich-Erzählerin an einer Stelle über die Schriftstellerin Lise. Es scheint, als wolle Tove Ditlevsen es im Buch ihres Lebens mit ihren inneren und äußeren Angstgegnern aufnehmen, allen voran mit Vilhelm alias Victor, ihrem größten Bewunderer (und Neider) und allerschärfsten Kritiker, der die wunden Stellen ihres empfindsamen künstlerischen Selbstvertrauens so gut kannte und traf wie kein anderer.
Literatur und Wirklichkeit korrespondieren hier auf atemberaubend grenzüberschreitende Weise miteinander und greifen aufeinander über.
Ihr erzählerischer Wagemut geht weit über die vielbeschworene Autofiktion hinaus, und man täte der Autorin unrecht, wenn man diesen Roman lediglich darauf reduzieren würde, ein Schlüssel- oder Enthüllungsroman zu sein. Literatur und Wirklichkeit korrespondieren hier auf atemberaubend grenzüberschreitende Weise miteinander und greifen aufeinander über – manchmal nehmen die fiktionalen Ereignisse die spätere Realität sogar vorweg. Tove Ditlevsen hatte einen genauen Plan davon, wie das Buch ihres Lebens enden sollte.

Porträtfoto Tove Ditlevsen
Ihrerzeit war sie nicht nur eine bekannte Autorin, sondern auch eine öffentliche Person, und spätestens seit der Veröffentlichung von »Abhängigkeit« geriet sie oft unfreiwillig ins Kreuzfeuer der Klatschpresse, die sie andererseits häufig selbst mit Homestorys und Interviews bediente (...) Obwohl sie ein gespaltenes Verhältnis zu ihrer eigenen Berühmtheit hatte und häufig damit überfordert war, liebte sie skandalträchtige Auftritte und inszenierte sich gern, manchmal mit unüberschaubaren Folgen. (...) Auch ihr Suizidversuch wurde medial begleitet und ausgeschlachtet. Nach einer großangelegten öffentlichen Suchaktion hatte man Tove Ditlevsen in letzter Sekunde an einem Waldrand im Norden Kopenhagens gefunden und wiederbelebt. Später verfluchte sie die »verdammten Lebensretter«, womit sie im übertragenden Sinne auch die Kirche und andere moralisierende Instanzen meinte.
Wieder einmal hielt das Schreiben Tove Ditlevsen am Leben.
Ruhe und Zuflucht fand sie einmal mehr in ihrer »Stamm-Psychiatrie« Sct. Hans, wo sie in ihren letzten Lebensjahren genauso viel Zeit verbrachte wie zu Hause. Sie schrieb an dem unvollendeten Manuskript von »Vilhelms Zimmer« weiter und ließ auch ihren unseligen Ausflug in den Wald mit einem Tablettenglas in der Tasche und einem Schlafsack unter dem Arm in den Roman einfließen. Lises Euphorie in den Stunden vor ihrem selbstgewählten Tod ist erschreckend eindrücklich. Wieder einmal hielt das Schreiben Tove Ditlevsen am Leben, doch beim Lesen befällt einen Unbehagen angesichts ihrer lebensmüden, lakonischen Ich-Erzählerin, die nur noch ihr letztes großes Werk zum Abschluss bringen will. Aus Tove Ditlevsens Briefen geht auch hervor, wie erschöpft sie in dieser Zeit war. Die Trennung von Victor, der Verlust einiger nahestehender Menschen und die von ihr (oft zu Recht) empfundene mangelnde künstlerische Anerkennung, nicht zuletzt seitens der dänischen Akademie, verstärkten ihre Depressionen und Süchte. Die Bewältigung des Alltags fiel ihr zunehmend schwer. (...)
»Vilhelms Zimmer« erschien in den zwei Wochen vor der Veröffentlichung bereits als Vorabdruck in der Tageszeitung Politiken, mit Illustrationen des bekannten Zeichners Arne Ungermann, auf denen Lise Mundus zum Verwechseln Tove Ditlevsen ähnelt. Die Auflagen der Zeitung schnellten in die Höhe, und auch das Buch ging bereits am Veröffentlichungstag in die dritte Auflage. Die Kritiker waren begeistert, trennten zu Victors Verwunderung und Verärgerung aber oft nicht zwischen Werk und Wirklichkeit und Vilhelm und Victor – genauso wenig wie Tove selbst in den Interviews, die sie nach der Veröffentlichung gab. Die Diskussionen um das Buch und die daraus resultierenden Angriffe auf Victors Person führten noch einmal zu einer Krise zwischen den beiden längst Getrennten, die sich emotional doch nie ganz voneinander lösen konnten.
Zuletzt lebte Tove Ditlevsen sehr zurückgezogen. Selbst ihren engsten Vertrauten, auch ihrer Psychologenfreundin Lise Haslund, hatte sie überzeugend einreden können, dass sie den Suizidversuch nicht wiederholen würde. Als sie damals in einem Interview zu den Gründen befragt worden war, hatte sie gesagt: »Es gab keinen besonderen äußeren Anlass. Ich wollte einfach nur nicht mehr leben.« Im März 1976 starb sie in der Wohnung einer verreisten Freundin an einer Überdosis Tabletten.
Die Autorin Tove Ditlevsen verabschiedet sich mit »Vilhelms Zimmer« eher trotzig und schelmisch aus der Welt.
Es fällt nicht schwer, Mitgefühl für Lise Mundus zu entwickeln, wie es die Ich-Erzählerin im Roman von ihrem Leser erbittet. Die Autorin Tove Ditlevsen verabschiedet sich mit »Vilhelms Zimmer« aber eher trotzig und schelmisch aus der Welt. Niemand anderes konnte und kann die Geschichte ihres Lebens »mit dem gleichen Recht und der gleichen Selbstverständlichkeit« erzählen, wie es im Roman heißt. Und obwohl sie scheinbar alles aufs Spiel setzt, arbeitet sie doch höchst bewusst mit Fakten und Fiktion, verwebt beides auf raffinierte und kaum trennbare Weise miteinander und verwirrt ihre Leserinnen und Kritiker. Es ist und bleibt die Autorin, die alle Schicksalsfäden in der Hand behält. »Ich möchte jetzt nur erzählen, wozu ich Lust habe«, verkündet die namenlose Ich-Erzählerin in »Vilhelms Zimmer« an einer Stelle. Der lapidare Satz passt in seiner Kompromisslosigkeit gut zu der radikalen Autorin, die man ausgerechnet in ihrem letzten Roman noch einmal völlig neu kennenlernt. Und gleichzeitig denkt man voller Bewunderung, dass Tove Ditlevsen in ihrem literarischen Werk streng genommen wohl nie etwas anderes getan hat.
Ursel Allenstein, 1978 geboren, studierte Skandinavistik und Germanistik in Frankfurt und Kopenhagen. Sie ist Übersetzerin aus dem Dänischen, Schwedischen und Norwegischen von u.a. Christina Hesselholdt, Sara Stridsberg und Johan Harstad. Für ihre Übersetzungen wurde sie vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Jane-Scatcherd-Preis der Ledig-Rowohlt-Stiftung.