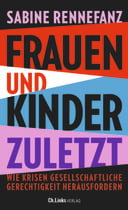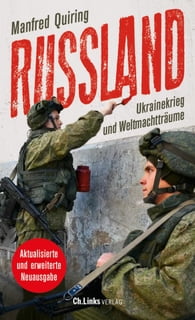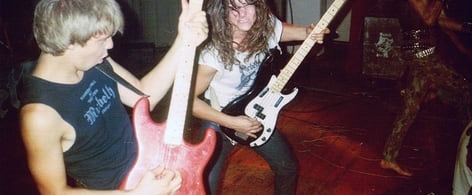Sabine Rennefanz: »Frauen und Kinder zuletzt«. Ein Interview.

Frau Rennefanz, Ihr Buch heißt »Frauen und Kinder zuletzt«. Wie kommen Sie auf den Titel?
Der Titel ist ironisch und auch provokant gewählt. Es geht darum deutlich zu machen, wer sich in Krise durchsetzt – und wer nicht. Ich habe das Buch vor allem für Frauen geschrieben, die versuchen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Vor der Pandemie haben wir das – und ich schließe mich da ein – nur mit Mühe und Not hingekriegt und in der Pandemie brach dann alles zusammen. Die Vorstellung davon, wie gleichberechtigt Frauen und Männer sind, in der Gesellschaft, aber auch zu Hause, wurde auf den Kopf gestellt.
Wie meinen Sie das?
Am Anfang der Pandemie hieß es ja, wir sitzen alle in einem Boot, das Virus trifft alle gleich. Heute wissen wir: Das stimmt nicht. Die Coronapandemie hat gezeigt, wie geringschätzig mit Frauen, aber auch mit Kindern und Jugendlichen umgegangen wird. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen: Das milliardenschwere Konjunkturpaket des damaligen Finanzministers Olaf Scholz ging zu 73 Prozent an Branchen, in denen überwiegend Männer arbeiten. Nur 4,2 Prozent ging an Branchen, in denen mehrheitlich Frauen arbeiten. Die Arbeit von Männern gilt als systemrelevant, die von Frauen nicht. Schulen und Kitas wurden handstreichartig geschlossen und es wurde erwartet, dass Frauen zu Hause bleiben und die Mehrarbeit übernehmen. Was sie auch taten. Die traditionelle Rollenverteilung erlebte ein Revival. Das wird lange nachwirken.
Frauen und Kinder zuletzt
Wie Krisen gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern
Ihr Buch beschäftigt sich mit Geschlechterrollen und Familiendynamiken während der Coronakrise, aber auch darüber hinaus. Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen und welche Schlussfolgerungen ziehen Sie?
Die Krise hat eigentlich gezeigt, wie wenig gleichberechtigt Frauen und Männer sind und wie viel in der Familienpolitik noch zu tun ist. Der Boden emanzipatorischer Errungenschaften ist immer noch überraschend wacklig. Vielleicht haben wir uns da kollektiv auch etwas vorgemacht und wollten nicht wahrhaben, wie traditionell Deutschland in Bezug auf das Verhältnis von Männern und Frauen noch ist, wie stark die klassischen Rollenbilder wirken und wie wenig sich strukturell geändert hat. Schon vor der Pandemie mussten Frauen mehr kämpfen, sie verdienten weniger, arbeiteten eher in Teilzeit, kümmerten sich mehr um Familie und Haushalt. Sie gingen schon mit einer schlechteren Verhandlungsposition in die Krise. Als es eng wurde, sind sie diejenigen gewesen, die mehr Fürsorge und Betreuung übernommen haben. Quasi automatisch. Das geht jetzt seit zwei Jahren so.
Mit »eng« meinen Sie sicher die Zeit während des ersten und zweiten Lockdowns und den damit verbundenen Schulschließungen …
Ja. Allerdings: Selbst als im vergangenen Winter die Schulen offengehalten wurden, sind viele Frauen wegen Quarantäne oder Erkrankungen zu Hause geblieben. Jede fünfte Frau hat laut Hans-Böckler-Stiftung im Januar 2022 ihre Arbeitsstunden reduziert – nur fünf Prozent der Väter taten das. Das ist bei den Frauen einer der höchsten Werte seit Beginn der Pandemie. Meines Erachtens ist das darauf zurückzuführen, dass viele Frauen sich im Homeoffice bei gleichzeitigem Homeschooling regelrecht zerrissen haben. Sie wollen beidem gerecht werden: Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung. Ganz viele Frauen stecken in einem Teufelskreis der Überlastung, haben während der Pandemie das Vertrauen in die Politik verloren. Das wird bisher leider kaum thematisiert. Außerdem hat die Krise noch einen weiteren Konflikt zutage gebracht, der eher selten offen angesprochen wird: Den Konflikt zwischen Jung und Alt.
Warum wird er Ihrer Meinung nach nicht angesprochen?
Weil so viel Sprengstoff darin steckt. Aber dieser Konflikt wird uns in den nächsten Jahren in einer alternden Gesellschaft weiter beschäftigen: Wir haben 14 Millionen unter-18-Jährige und 21 Millionen über-60-Jährige. Die zahlenmäßige Übermacht der Älteren hat natürlich auch die Coronapolitik bestimmt.
Ist die Coronakrise Auslöser oder Katalysator der von Ihnen beschriebenen Ungerechtigkeiten?
Eher ein Katalysator. Nehmen wir zum Beispiel die Schulen: Unser öffentliches Bildungssystem war schon vor Corona chronisch krank: Es ist ungerecht und vor lauter Reformen und Pisa-Angst in sich erstarrt. Wer es sich leisten kann, kauft sich heraus. Die Krise hat dann alle Unzulänglichkeiten mit großer Brutalität ausgeleuchtet: Die nicht vorhandene Digitalisierung, die veraltete Infrastruktur, der massive Mangel an Personal, und damit meine ich nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen. Und das Schlimmste ist, dass es kaum jemanden interessiert, wie es den Kindern und Jugendlichen eigentlich geht, was sie brauchen, stattdessen sollen sie vor allem »Lernstoff« nachholen. Was die Schulschließungen und Kontakteinschränkungen für Kinder bedeutet haben und immer noch bedeuten, spielt ebenfalls eine nachrangige Rolle. Corona ist für Kinder und Jugendliche nicht nur eine Momentaufnahme, sondern eine prägende Erfahrung.
Gibt es positive Entwicklungen, die die Krise angestoßen hat?
Was ich beschrieben habe, mag negativ klingen. Aber ich glaube daran, dass es heilsam ist, in die Wunden einer Gesellschaft zu gucken und sich selbst, seine Prioritäten im Leben zu hinterfragen. Corona zwingt uns dazu.
Wie haben Sie persönlich die letzten zwei Jahre erlebt?
Die Krise hat mich oft an meine Grenzen gebracht. Es hat mich sehr frustriert, wie wenig die Bedürfnisse von Eltern bei den politischen Entscheidungen eine Rolle gespielt haben. Ich habe die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oft als unmöglich empfunden – und wenn mir das schon so geht, als relativ privilegierte, weiße, verheiratete Mittelschichtsfrau, wie sehr müssen dann erst andere, wie zum Beispiel Alleinerziehende, kämpfen? Ich habe im Herbst 2021 eine radikale Entscheidung getroffen und meine Festanstellung als leitende Redakteurin aufgegeben, um mich selbstständig zu machen. Das wäre wahrscheinlich ohne Corona nicht passiert.