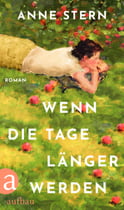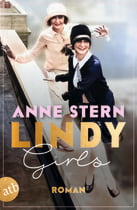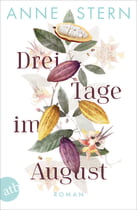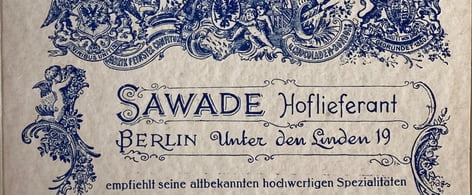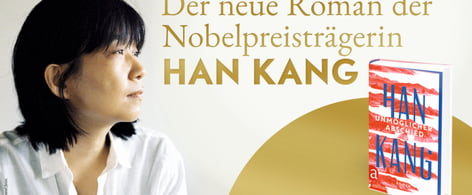Bestsellerautorin Anne Stern erzählt von Sommer, Vergangenheit, Gegenwart und ihrem neuen Roman

Wenn die Tage länger werden
Roman
»Sie schloss einen
Moment die Augen,
spürte die Wärme im
Raum auf ihrem Gesicht.
Der Duft nach Sommer
wurde stärker. Das uralte
Glücksgefühl schlich
heran, wie jedes Jahr,
wenn die Ferien
begannen«
In deinem neuen Roman »Wenn die Tage länger werden« beschreibst du den Sommer so lebendig, dass man seine Düfte und Farben förmlich spüren kann. Gibt es für dich persönlich einen besonderen Sommer, der dir immer in Erinnerung bleiben wird?
Ich glaube, für jede:n von uns sind es die Sommer unserer Kindheit, die uns immer noch sehr gegenwärtig sind. Als Kind erlebt man einen Sommer in erster Linie körperlich, und daher wohnen die Erinnerungen auch im Körper. Ich kann mich auf reiner Sinnesebene an jeden dieser Sommer erinnern. An den Geruch von aufgeheizten Heuballen auf den Deichwiesen an der Ostsee, wo ich beinahe jeden Sommer verbracht habe, an den Geschmack von Landjägern, die mein Onkel immer auf unsere Wanderungen durch den Schwarzwald mitnahm, an den Chlorgeruch im Schwimmbad und das Glitzern der Pfützen auf dem Waschbeton, daran, wie rot die Erdbeeren leuchteten, die meine Mutter uns auf dem Balkon bereitgestellt hatte, wenn wir aus der Schule kamen.
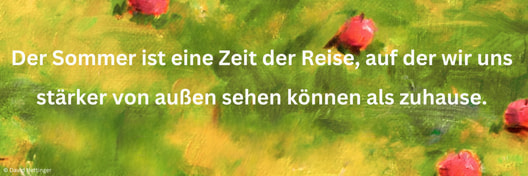
Einen Sommer werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Es war der erste Sommer, den ich als Siebzehnjährige ganz ohne meine Familie in Frankreich verbracht habe. Noch heute weiß ich, wonach dieser Sommer gerochen und geschmeckt hat - nach vollkommener, unendlicher Freiheit, aber auch nach dem Alleinsein. Letztlich haben wir immer zwei große Sehnsüchte - die nach Zugehörigkeit und die nach Freiheit. In diesem Konflikt müssen wir immer bleiben, und im Sommer tritt er oft stärker zutage, weil der Sommer eine Zeit der Reise ist, auf der wir uns stärker von außen sehen können als zuhause.
Deine Protagonistin Lisa steht vor der Herausforderung, ihre Identität jenseits ihrer Mutterrolle wieder für sich zu definieren – wie war es für dich, diese Suche nach der Frau abseits der Mutter zu beschreiben? Welche Aspekte von Lisas Entwicklung haben dich besonders interessiert?
Nach meiner eigenen Erfahrung verändern wenige Dinge so sehr die eigene Identität oder Selbstwahrnehmung wie der Moment, in dem man ein Kind bekommt. Und für diejenige, die es auf die Welt bringt, ändert sich noch viel mehr als Zeitkontingente oder Lebenspläne. Es ist eine extrem körperliche Erfahrung, ein Kind zu gebären. Dieses Kind hängt nach der Geburt in den meisten Fällen auf existentiellste Weise vom mütterlichen Körper ab, es verlangt ein Maß an Aufmerksamkeit, körperlicher und psychischer Zugewandtheit und zumindest am Anfang auch an Selbstaufgabe, das kaum mit dem allgemeinmenschlichen Wunsch nach Autonomie vereinbar ist.
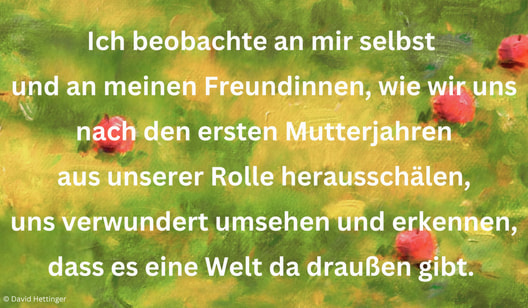
Aber nichts bleibt, wie es ist, alles verändert sich ständig. Und irgendwann kommt der Moment, wo unser Körper wieder ein Stück weit uns selbst gehört, niemand mehr einen täglichen (und nächtlichen) Anspruch darauf erhebt. Dass wir jetzt wieder mit ihm anfangen dürfen, was wir wollen, ihn wieder genießen und nur für uns benutzen dürfen. Gleichzeitig wird man nie wieder dieselbe Frau wie vor der Mutterschaft werden, und manche Frau betrauert das vielleicht auch. Das sind Prozesse, die sehr wichtig, manchmal schmerzhaft, aber auch ungeheuer befreiend sein können, und davon wollte ich erzählen.
Du bist vor allem als Autorin historischer Stoffe bekannt. Bei »Wenn die Tage länger werden« ist der Schwerpunkt der Handlung in der Gegenwart angelegt. Was hat dich gereizt, diesen Schritt zu wagen und die Geschichte in der heutigen Zeit anzusiedeln?
Ich stehe beim Schreiben immer mit einem Fuß in der Vergangenheit. Schreiben heißt für mich, sich an etwas zu erinnern und diese Erinnerung darzustellen - egal, ob ich es selbst erlebt habe oder ob es jemand anders erlebt haben könnte. Historische Fakten und Fiktion gehen dabei eine Allianz ein, sie vermischen sich derart, dass ich sie manchmal nicht mehr genau unterscheiden kann. Das ist für mich der Moment, in dem eine Geschichte beginnt.
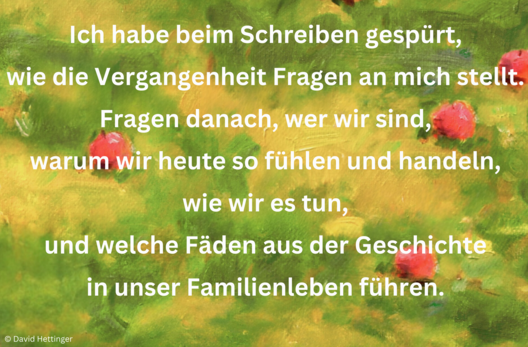
Mein Roman »Wenn die Tage länger werden« spielt zwar vordergründig in der Gegenwart, aber darunter liegt die Vergangenheit der Figuren, ihrer Familien und letztlich eines ganzen Landes wie die Grundierung eines Gemäldes. Sie schimmert durch die Handlung, sie ist der Motor für die ganze Geschichte. Insofern unterscheide ich gar nicht allzu sehr zwischen einem sogenannten historischen und einem gegenwärtigen Stoff - einer existiert nicht ohne den anderen. Etwas war aber doch anders - in meinen historischen Romanen kann ich mich als Autorin ein Stück weit hinter dem historischen Erzählen verstecken, ich kann zumindest so tun, als ginge mich das alles gar nicht so viel an. Beim Schreiben an »Wenn die Tage länger werden« war ich als Erzählende der Gegenwart viel stärker involviert.