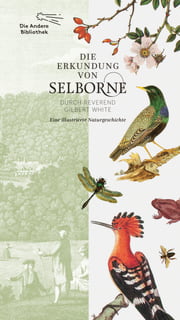Auf der »Jagiełło«

Übersetzt von Ron Mieczkowski
Madeira. Morgens, noch vor dem Frühstück, bin ich aufs Deck gegangen. Der Ausblick war fantastisch. Vor Madeira ragen ein paar riesige, schwarze Felsen aus dem Meer. Wuchtig gleiten sie im Nebel. Es scheint so, als wären sie eben erst aus der Tiefe emporgetaucht. Diese einsam hervorragenden Blöcke, ohne Halt an irgendeinem Festland (Madeira liegt hinter Wolken) sind ein ganz vorzeitlicher, geheimnisvoller Anblick. Man denkt an die Schöpfung der Welt, an irgendgroße Kataklysmen. Die Felsen liegen auf der Lauer, sind lebendige Ungeheuer.

Der Horizont wird langsam durchsichtig und in den Wolken erscheint Madeira. Gelbliche Vegetation an Böschungen, die Gipfel immer noch nebelverhangen. Wir fahren an der Küste entlang. Die Berge sind von Schluchten und Spalten durchschnitten, deren Rinnen bis zum Meer reichen. Die Insel erinnert an eine umgedrehte Kuchenform. Etwas weiter ist Funchal zu sehen. Weiße Häuschen, verteilt auf grüngelben Hängen wie Schafe auf einer Alm. Das Wasser ist veilchenblau, der Himmel hellt sich immer schneller auf, und Funchal erreichen wir schon in der Sonne. Im Hafen Kähne, einige weiße Segelboote und ein schmaler Dreimaster, das Schulschiff der portugiesischen Marine.
Die »Jagiełło« drosselt das Tempo. Bolek jagt mit seinem gravitätischen »Everybody rrrraus« das Gesindel vom Bug, und wir setzen den Anker. Vom Ufer sind schon Boote mit Waren herangeschwommen und der Handel beginnt. Unten schwimmen ganze Auslagen. Korbliegen und -sessel werden arrangiert, Spitzendecken ausgelegt, Strohhüte mit aufgenähten Blumen aus vielfarbigem Tuch, Körbchen, bestickte Beutel, Früchte. Auf dem Deck herrscht Stimmengewirr, wir haben Landgang. Uns werden Aufenthaltskarten ausgeteilt, aus den Lautsprechern kommen Kundmachungen und Unterrichtungen, einer meiner Landsleute brüllt mir ins Ohr »Pan B. – was meinen Sie, was kostet der Eintritt auf dieses Madeira?«, Gedränge und Geschubse. Motorboote fahren schon zwischen Land und Schiff hin und her.

Um kurz nach neun landen wir und nehmen die ersten fünfhundert Meter der Küste im Sturm, liefern uns schwere Gefechte mit Scharen von Agenten und Mittelsmännern, die Busfahrten, Taxis und den ganzen Besichtigungspietz mit Anfassen der ganzen Insel anbieten. Sie stürzen sich auf uns wie ein Rudel ausgehungerter Wölfe, greifen uns, reißen an uns, verfolgen uns von der Seite, drängen uns ab. Ich beschimpfe sie in allen mir bekannten Sprachen – vergeblich.
Kein Wunder. Hier ist kaum Verkehr, die Insel, die ihre Haupteinnahmen dem Tourismus verdankt, pfeift aus dem letzten Rohr. Die Zeiten der croisières sind vorbei, immer weniger Leute können sich einen Erholungsurlaub auf Madeira leisten. So ist sogar ein ärmlicher Emigrant, der hier zu einem Zwischenhalt einläuft, ein seltener Glücksfall.
Heute ist Peter-und-Paul und die Leute gehen in die Kirchen. Die Kirchen sind klein und hübsch. Ihre weißen Mauern, von schwarzen Balken eingerahmt, glänzen in der Sonne. Auf den Türmen sind die Zwiebelkuppeln mit weiß-blauen Majolika-Schindeln bedeckt. Ihre Innenräume haben etwas von unseren Dorfkirchen, sie sind genauso farbenfroh und opulent. Auch die Wände sind mit Majolika-Kacheln gefliest, aus der Ferne machen sie den Eindruck von Mosaiken. In den Bänken sitzen Frauen mit schwarzen Kopftüchern.
Die Straßen sind von frappierender Sauberkeit. Die großen und kleinen Häuser sehen aus, als seien sie erst gestern errichtet. Sorgsam gepflegt, tadellos in Schuss. Das schwarze Straßenpflaster besteht aus Vulkangestein in der Form von schmalen Tetraedern, die nebeneinander mit ihren Spitzen in die Erde geschlagen wurden. Glatt gerieben sind sie von Schlittenkufen. All diese kleinen Straßen ranken sich steil nach oben. Zu ihren Seiten fließt ein reißender Bach in einer Steinrinne, aus dem die sich in alle Richtungen erstreckenden Gärten bewässert werden. Sie sind wahrhaft paradiesisch. Ständig spritzt hinter einer Mauer ein Wasserfall aus Blumen auf die Straße, schäumen Bougainvillea, öffnen ihr orchideengleiches Inneres in großen, weißen Kelchen, kriechen tellergroße, saphirblaue Winden mit rosa Herzen hervor. Es duftet. In den Gärten sind mal kletternde Weinsträuche, sie bilden Dächer und lange, schattige Schiffe, mal Bananenhaine mit Kandelabern, in denen grüne Früchte stecken.
Wir gehen immer weiter den Berg herauf, bis wir eine stattliche Höhe erreichen. Das Meer verbindet sich mit dem blassen Hellblau des Himmels, es ist heiß. Jedes der kleinen Häuser, an denen wir unterwegs vorbeigekommen sind, hat einen kleinen Hof, ausgelegt mit eiförmigen Steinchen aus dem Meer, die verschiedene Muster ergeben. Dazwischen, wie Inselchen, kleine Blumenbeete. Bisweilen ist das gar zu schön, zu sauber, überhaupt allzu sehr eine Puppenhausumgebung. In einem kleinen Laden, schon weit oben, trinken wir Limonade und kaufen etwas Brot, Wurst und Tomaten. Alles zusammen zwölf Escudos. Ich zahle in Dollar, vor Nervosität bekomme ich einen Tick, und bekomme zwölf Escudos Restgeld – ganz nach Vorschrift, zum Wechselkurs. Danach setzen wir uns in einem der hängenden Gärten in den Schatten eines Feigenbaums und essen. Die Stille mittäglicher Hitze. Eine Insel wie aus Träumen. Und auch die Wurst: vorzüglich.
Gegen drei kehren wir zurück in den Hafen und steigen auf ein Motorboot. Die „Jagiełło“ wird immer noch von Händlern belagert, Münztaucher versuchen auf unser Motorboot zu gelangen, springen ins Wasser und tauchen mit silbernen Scheiben im Mund wieder auf. Zwei Italienerinnen schmeißen silberne Geldstücke ins Wasser, lachen, wie sie so mit souvenirs behangen dasitzen, summen vor sich hin, Platscher im veilchenblauen Wasser – das ist… dafür habe ich keine Worte.
Um vier Uhr nachmittags legen wir ab. Ich sitze auf dem Liegestuhl, die schwarzen Felsen von Madeira verschwinden im Nebel. Die Sonne neigt sich zum Abend, und plötzlich fliegt etwas Silbernes hoch über dem Wasser, das von dort losgesprungen ist und jetzt wieder mit einem Platschen zurückfällt. Der erste fliegende Fisch. Erinnerungen an Bücher aus Kinderjahren. Jetzt acht Tage Meer bis La Guaira.