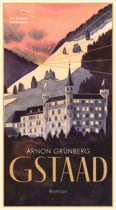»Das Provozierende ist die Realität selbst«

»Gstaad« ist ein Buch, das menschliche Abgründe ausleuchtet und an Tabus rüttelt. Niemand, der es gelesen hat, wird es je wieder vergessen. Wie sehr ging es Dir bei diesem Buch darum, zu provozieren?
Arnon Grünberg: Darum ging es mir gar nicht. Provokation nur um der Provokation willen interessiert mich nicht besonders. Die Abgründe sind ja nicht von mir erfunden. Es gibt diese Abgründe, und man sollte darüber sprechen, auf der Bühne, im Roman, wo auch immer. Literatur soll, wie Kundera gesagt hat, die Decke von der Realität ziehen. Überall versucht man, es uns so bequem wie möglich zu machen, auch ich sitze und liege am liebsten bequem. Aber wir ahnen ja, dass es hinter dieser Bequemlichkeit eine andere Welt gibt. In allen meinen Romanen geht es darum, diese Welt zu zeigen. Gewiss finden manche das dann provozierend, aber das Provozierende ist die Realität selbst. Ich zeige nur, was es gibt – und dass das Komische und das Grausame oft zusammen geht. Zwischen der Welt und unserer Moral gibt es eine Kluft. In diese Schlucht hinein wird Literatur geboren.
Im Mittelpunkt des Romans steht ein obsessives Mutter-Sohn-Verhältnis. In der Perspektive eines scheinbar naiven Erzählers folgen die Leserinnen und Leser einem Erwachsenwerden zwischen brutaler Befreiung, Selbstermächtigung und Unterwerfung. Wie bist Du zu diesem Protagonisten gekommen?
Eltern-Kind-Verhältnisse interessieren jeden, auch mich. Man sollte vorsichtig sein mit dem Wort »Muse«, aber meine Mutter war meine Muse, das traue ich mich zu sagen. Diese Obsession, die da besteht oder häufig besteht, hat ja auch ihre Gründe. Das Kind hat Gott ersetzt; weil wir immer weniger Kinder bekommen, wird das einzelne Kind immer wichtiger. Ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter, aber man sollte nicht alles autobiografisch und psychologisch deuten in dem Glauben, man würde dann alles verstehen. Dadurch wird auch alles wieder harmlos. Das langweilt mich.
Ich wollte zeigen, wie ein Kind für eine Frau, die alleinerziehend ist, zum Weg aus der Einsamkeit wird. Und was das für das Kind bedeutet. Wie ein Kind unter diesen Voraussetzungen erwachsen wird – oder gerade auch nicht. Es ging für mich um die Beschreibung einer Strategie, die Einsamkeit zu überwinden, mit unerwarteten Nebenwirkungen. Ohne zu sagen: Die Mutter ist an allem schuld.
Das ist interessant. Schuld war für Dich überhaupt kein Thema?
Nein, Schuld war für mich kein Thema. Zu sagen, der oder die ist schuld, ist ja oft sehr einfach. Wir reden viel zu schnell über Schuld, nur weil wir nicht wirklich hinschauen möchten.
Bei der Lektüre Deines Buches kommen einem verschiedene literarische Bezüge in den Sinn. Grimmelshausens »Simplicissimus« und Thomas Manns »Felix Krull«, Voltaires »Candide«, aber auch »Lolita« und »American Psycho«. Was bedeuten literarische Vorbilder für Dich?
Ohne Vorbilder geht es nicht. Wir sind intelligente Affen, und weil wir so intelligent sind, können wir gut imitieren. Das heißt selbstverständlich nicht, dass ich mich für einen Imitator halte, aber man lernt Schreiben durch Lesen und Leben. An »American Psycho« habe ich gar nicht gedacht, und von Nabokov ist mir »Gelächter im Dunkel« viel lieber als »Lolita«. Es ging mir auch nicht um die Sexualisierung eines pubertären Kindes, das haben wir oft genug gesehen und gelesen. Wichtig war für mich die Frage: Was ist ein Kind? Und was bedeutet ein Kind für einen Erwachsenen, der selbst Kind geblieben ist.
Große Teile des Romans spielen an deutschen Schauplätzen, in Heidelberg, Baden-Baden und Stuttgart. Du hast selbst deutsche Wurzeln. Dein jüdischer Vater floh 1933 aus Berlin und überlebte als einer der wenigen der Familie die nationalsozialistische Verfolgung. Welche Rolle spielt Deutschland in Deinem Schreiben?
Meine Mutter ist auch jüdisch und in Berlin geboren und hat mehrere KZs überlebt. Also, meine Eltern waren sehr deutsch. Zu Hause in Amsterdam gab es die »Hörzu« und den »Stern«, mein Vater hörte »Deutsche Welle«, meine Mutter backte Streuselkuchen. In den Sommerferien ging es nicht nach Italien, sondern nach Hahnenklee und Braunlage, Tegernsee und Bad Neuenahr, Hinterzarten und Titisee. Ich möchte noch mal ein Sachbuch schreiben: »Deutschland, ein Kurort«.
Zurück zur Frage: Ich wohne seit 1995 in den USA, ich möchte gern Amerikaner werden. Damit würde ich meinen holländischen Reisepass verlieren, aber ich kann einen deutschen Reisepass beantragen. Wenn alles gut geht, werde ich mein Leben als amerikanischer Deutscher beenden. Das ist mehr als ein bürokratischer Akt. Ich habe gar kein Bedürfnis, Deutschland zu idealisieren, aber ich glaube, mein Bedürfnis dazuzugehören, ist historisch gerechtfertigt. Was ist Identität? Wieviel Heimat braucht man? Das sind persönliche, aber auch gesellschaftlich wichtige Fragen. Diese Fragen hängen für mich auch mit Deutschland zusammen. Ich bin noch nicht fertig mit Deutschland.
»Gstaad« ist erstmals 2002 erschienen unter dem Pseudonym Marek van der Jagt. Was hat es mit diesem Pseudonym auf sich?
Ich habe ja einige Bücher unter Pseudonym geschrieben. Auch »Die Geschichte meiner Kahlheit« – auf Deutsch »Amour Fou«. Ich wollte mich damals von dem Bild befreien, das sich die Öffentlichkeit, vor allem in Holland, von mir gemacht hat. Die öffentliche Rolle des Schriftstellers ist nicht selten der Feind des Buches. Je mehr man Schriftsteller spielt, desto weniger schreibt man. Und ich wollte zeigen, dass Identität fließend ist. Wir sind nicht Gefangene der Tradition oder von unseren Eltern. Es gibt eine gewisse Freiheit, und die sollte man ausschöpfen.
Unsere Gesellschaft heute ist geprägt von Debatten darüber, was öffentlich gesagt werden darf und von wem. Möglichst keinen Anstoß erregen – mit dieser Erwartungshaltung treten immer mehr Menschen auch an Kunst und Literatur heran. Wie blickst du auf diese Debatten? Welche gesellschaftliche Aufgabe hat Literatur in Deinen Augen?
Wir sind uns heute bewusst, dass unsere eigenen Empfindlichkeiten nicht die einzigen und nicht die einzig gültigen Empfindlichkeiten sind. Zur gleichen Zeit, und vielleicht ist das unvermeidlich, wird viel zu viel in Kategorien von »Opfer« und »Nicht-Opfer« gedacht. Wir zählen Privilegien wie einst das Geld. Es gibt kulturelles Kapital, aber es gibt auch Opfer-Kapital und damit Opfer-Konkurrenz. Wer ist am meisten Opfer? Wer hat mehr gelitten? Aus dieser Perspektive kann man leicht sagen, das verletzt mich, das beleidigt mich, oder: Darüber darfst du nicht schreiben, das ist mein Thema! Jedes Verbot, jede Verbannung ist eine Niederlage.
Das gesellschaftliche Spiel mit der Empörung macht vielleicht einigen Vergnügen, aber darüber hinaus bringt es wenig. Wenn wir Kunst und Literatur als das sehen, was nur keinen Anstoß erregen soll, verraten wir Kunst und Literatur. Nicht weil wir immer und überall Anstoß erregen sollen, sondern weil Literatur und Kunst dorthin zielen sollte, wo es gefährlich werden kann. Wenn man nur hören und lesen möchte, was man ohnehin schon dachte, kann man es auch sein lassen.
Literatur braucht Kritik, Kunst braucht Kritik. Da können und sollen Diskussionen stattfinden. Da kann und soll man auch sagen: Wir müssen nicht über alles diskutieren. Die Frage ist: Worüber sind wir uns einig? Hinter der Empörung steckt das Bewusstsein, dass wir uns über fast nichts mehr einigen können. Anstoßnehmen ist oft auch Angst, und Angst ist kein guter Ratgeber. Die Moralisierung von Kunst und Literatur macht die Gesellschaft nicht besser, nur die Kunst und Literatur schlechter.
Das Gespräch führte Rainer Wieland