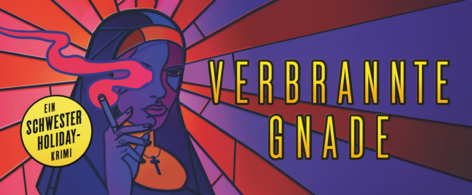Eine traurigschöne Mutter-Tochter-Geschichte mit poetischer Strahlkraft

Paulina Czienskowski lässt in ihrem zweiten Roman eine junge Frau davon erzählen, wie sie die Angst vor Sprachlosigkeit mit der Geburt ihres Kindes überkommt. Weil ihre Mutter und Großmutter stumm in ihren eigenen Leben stehen, imaginiert sie zwischen Erinnerung und Fantasie gegen die drohende Stille an. Liebe und Verlustangst vereinnahmen sie in dieser Zeit eigener Umwälzungen und im Gefühl zwischen den Welten zu stehen. Überall stößt sie hier auf alte Wunden, Pflichtgefühl und ein Weitermachen, auf die Frage nach Zugehörigkeit, als sie begreift, wie Scham Menschen verstummen lassen kann.
Dem Mond geht es gut
Roman
In »Der Mond geht es gut« geht es viel um Sprachlosigkeit, um das Suchen nach den richtigen Worten. Ist es Ihnen schwergefallen, eine Sprache für diese Themen zu finden?
Ich habe lange gebraucht, Klarheit über das Wie zu gewinnen und mit der Zeit begriffen, dass es für mich das »Schreiben über« ist, das die Sprachlosigkeit sowie Hilflosigkeit im sich (sprachlich) an sich und andere Annähern zeigen kann. Mutter und Großmutter kommen zwar zu Wort, aber nur durch die vorgegebenen Imaginationen und Rückschauen der Erzählerin, die sich vignettenartig, manchmal fragmentarisch erzählen. Die Tochter adressiert die Mutter direkt, allerdings ohne überhaupt eine Antwort abzuwarten und wenn, scheinen dialogische Momente oft nicht zu glücken, womit auch ein familiäres Erinnern nur schwer möglich wird. Der Text als Monolog, der verhallt, wie auch die meisten Versuche von Gesprächen. Die Erzählerin will erinnern, während der Text als solcher wie eine Meditation über Familie und ihre Brüche, über sprachlose oder sprachlos gemachte Frauen erscheint.
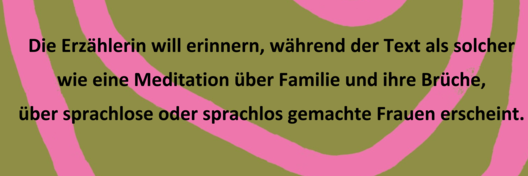
Ihr Text wirkt schwebend, suchend, tastend, ähnlich wie es die Protagonistin ist. Was macht für Sie Ihren Schreibstil aus?
Ich schreibe in meinen Texten einem Gefühl nach. Vielleicht ist es eine Art Angst vor der Nichtigkeit, vor der Stille, dem Tod auch, die mich hier treibt. Es sind innerliche Texte, in denen ich versuche, Zustände fühlbar zu machen, Emotionen erlaube, gesehen zu werden. Momente, die mit wenigen Strichen ganze Jahre erzählen, wechseln sich ab mit Close-Ups. Durch diesen teils haltlos nahen Blick will ich unter die Oberfläche der Figuren vordringen. So werden sie körperlich, obwohl sie im Text entkörpert, raum- und zeitlos scheinen, sich selbst und einander kaum nah sind. Während ich schreibe, folge ich den Klängen der Worte, einem Rhythmus, der den Text wie eine Emulsion zusammenhält, bis er zwischen Inhalt und Erzählstimme resoniert.
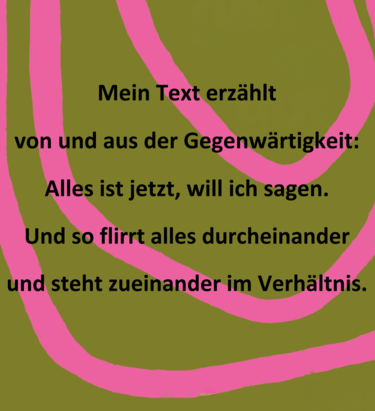
Ihr Roman fühlt sich ein bisschen an, wie in einer Echokammer, die Figuren verstehen, dass sie abhängen von dem, wie sie durch ihre Familie geprägt sind. Ist das nicht ein erschreckender Gedanke?
Ich glaube, Momente von Anfang und Ende eines Lebens lenken den Blick auf den eigenen Weg. Die Erzählerin fühlt sich in der liminalen Phase gefangen. Das Gefühl auf endlos langen Fluren zu stehen, bestimmt sie. Gerade durch die gnadenlose Spiegelung durchs eigene Kind fällt auf, was Eltern bedeuten: verantwortlich dafür, dass wir leben und unser Gepäck, das wir bis zum Ende mit uns tragen. Ob sie anwesend oder abwesend sind, spielt dabei nicht die entscheidende Rolle, weil auch das Abwesende eine Präsenz trägt, wo doch alles zumindest durch zwei Generationen sickern soll. Erschreckend, ja, weil entsprechend niemand befreit scheint. Eine positive Lesart könnte sein: Verbindungen zu spüren durch Kontunitäten; zu begreifen, ein Teil einer vor Ewigkeiten angelegten Erzählung zu sein und diese auch selbstwirksam fortführen zu können.
Ist es eine grundlegend weibliche Perspektive auf die Welt und Nachkommenschaft, die uns der Roman vorführt, oder könnten Väter sich ähnliche Gedanken machen?
Der Text erzählt von weiblichen Körpern, denen Sprachlosigkeit von klein auf eingeschrieben wird, um den vorgegebenen Handlungsspielraum zu normieren. Und auch wenn Sozialisierungsprozesse verändert wären: Stimmen und Erfahrungen vergangener Generationen bleiben bestehen. Umso spannender finde ich, wo sich hier Väter, Großväter, junge Männer einfügen. Ein anderer Aspekt ist der Gedanke, dass man für immer Kind bleibt, der ja universell zutrifft. Dass man Erzeuger:innen bzw. Eltern hat und sich im Nachwuchs wiederfindet. Der Versuch, sich einer Wahrheit anzunähern, im Wunsch darüber, Klarheiten über das eigene Sein zu erlangen, darf jeden Menschen antreiben. Eine Suche, die unerschöpflich ist, und ihr Ende vielleicht auch eine Form von Utopie schreibt, könnte ein Motor dafür sein, sich selbst in der Welt zu begreifen und die eigene Existenz immer wieder aktualisieren zu wollen.