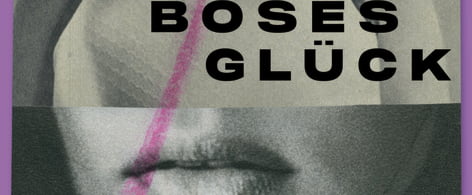»Du kannst im Kinderzimmer warten, bis wir fertig sind mit Essen«
Die Keimzelle deines Buchs bilden Kolumnen, die auf dem Blog »Hauptstadtmutti« erschienen und hohe Wellen schlugen, v.a. dein Text zum Thema »Einschulung«. Wann dämmerte dir, dass eine migrantische Perspektive auf das Thema Elternschaft ein ganzes Buch tragen würde? Und warum gibt es ein solches eigentlich noch nicht?
Migrantenmutti
...
Ich weiß nicht, ob es das so noch nicht gibt – ich habe es zumindest nicht gefunden. Natürlich gibt es jede Menge tolle Bücher von Migra-Eltern in Deutschland, angefangen mit Betiel Berhe oder Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-Dundadengar. Auch Olga Grjasnowa hat ein super Buch über Mehrsprachigkeit geschrieben.
Es gab auf den ersten Blick keinen richtigen Zeitpunkt, an dem ich mich für das Buch entschied. Die Mutterschaft selbst hat mich sehr schnell erfahren lassen, dass ich viele Dinge anders sah als meine Berliner Medienblase. Dann dachte ich nach dem Umzug in die ostwestfälische Heimat, dass es vielleicht ein Stadt-Land-Ding ist oder vor allem mit Klassenzughörigkeit zu tun hat. So oder so habe ich mich immer noch meiner Bougie-Bürgi-Blase zugehörig gefühlt. Schlussendlich verlor ich während der Lockdowns jeden Respekt gegenüber einer bestimmten Schicht, der es eigentlich gut ging. Während um mich herum Menschen ihre Existenzen aufgeben mussten oder in multipler Schutzkleidung Schicht um Schicht abarbeiten mussten, war alles, was viele besser gestellte Eltern gejuckt hat, ob es ok ist, wenn ihre Kinder eine Viertelstunde mehr fernsehen am Tag.
Deine Texte, die der Mehrheitsgesellschaft klug den Spiegel vorhalten, basieren auf deinen persönlichen Erfahrungen als aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommenes Kind. Was war der erste Culture Clash in der neuen »Heimat«, an den du dich erinnerst?
Der berühmte Satz: »Du kannst im Kinderzimmer warten, bis wir fertig sind mit Essen«, von Eltern von Schulfreundinnen. Undenkbar eigentlich.
Die Kapitel »Hausschuhe« und »Tisch« haben mir die Augen geöffnet, was Gastfreundschaft bedeutet. Wie könnte man es schaffen, dieses bei Migrant:innen ganz anders gelebte Konzept in der Mehrheitsgesellschaft zu implementieren? Geht so was überhaupt?
Klar, und ich möchte hier auch betonen, dass es natüüüüüürlich nicht »alle« sind. Gerade mein Studium in Bayern war pure Gastfreundschaft. Es ist ja in meiner russlanddeutschen Community schon fast obsessiv, wie viel Essen auf dem Tisch steht, wenn du nur schnell auf einen Kaffee vorbeikommen wolltest. Oder in der arabischen, oder bei vietnamesischen Freund:innen. Essen ist eine Priorität, eine sogenannte Love Language, man zeigt damit, dass man sich sorgt. Es schadet auch nicht, unseren Kindern einfach mal zu sagen, dass wir sie lieben oder stolz auf sie sind. Aber stattdessen stellen gerade viele Migras ihnen krass leckeres Essen hin. Das mit der in Worte gefassten Zuneigung macht meine Generation aber schon viel besser. Nur die Hausschuhe, die stehen nicht zur Diskussion. Straßenschuhe bitte in Wohnräumen ausziehen!
Heutzutage sind Insta-Moms allgegenwärtig. Ihre Takes über Bedürfnisorientiertheit & Co. setzen Eltern durchaus auch mal unter Druck. In deinem Buch schreibst du über einen der Wegbereiteter des Insta-Moms-Phänomens: das Reality TV. Was genau hat »Frauentausch« mit Instagram zu tun?
Bevor wir Frühstückdosen und #OOTD hatten, bzw. bevor wir die Möglichkeit hatten, uns von ihnen »inspirieren« zu lassen, hatten wir Frauentausch. Und mit »inspirieren« meine ich lästern, uns selbst erheben, wissen, was das Beste für wildfremde Kinder ist, und dass all diese (vornehmlich) Mütter sowieso nur verlieren können, also alles falsch machen. Diese Wertungen hat das Publikum bei Frauentausch schon vorgenommen. Mütter wurden gegeneinander ausgespielt, eine von ihnen war das fleißige Lieschen, die andere das faule Pendant. Wer die Serie schon mal geguckt hat, weiß, dass es in ihr um Faulheit gegen Fleiß geht, um gute vs. schlechte Mutterschaft. Und wir sitzen grölend und verhöhnend im Kolosseum, während auf dem Bildschirm im Kern oft Wohlstand gegen Armut antritt, doch das kontextualisiert niemand. Wir gucken einer Familie zu, die es angeblich geschafft hat, weil sie hart gearbeitet hat; die andere Familie hat kein Geld oder bezieht Hilfen, weil sie sich nicht genügend bemüht. Systematische Armut? Wird nicht erwähnt. Gerade erst hat ja die Elterngelddebatte herrlich gezeigt, dass wir es immer noch nicht schaffen, Armut überhaupt zu sehen, anzuerkennen, dass Kinder in diesem Land hungern. Stattdessen glauben wir, dass wir es alle schaffen können, wenn wir nur hart genug arbeiten.
Wenn du drei Take-Away-Botschaften deines Buchs nennen müsstest, wie würden die lauten?
Erstens, wenn man sich Gedanken um die eigenen Kinder macht, Zeit hat, Zuckergehalt von Cerealien zu recherchieren oder z.B. die »beste« Grundschule für das Kind sucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es diesen Kindern gut gehen wird. Sehr gut sogar.
Zweitens, wenn man alles richtig machen will, wird man nichts korrekt machen.
Und drittens die Wertschätzung dessen, dass Migra-Eltern neben dem ganzen Elternkram auch noch den ganzen Migra-Kram machen. Inklusive Racial Profiling, Diskriminierung bei der Arbeits-/Wohnungssuche, die man aufgrund von Nachnamen noch nicht mal richtig aufnehmen kann, Scham aus der Kindheit, die man überwindet, Traumata, die man aufarbeitet und potentielle Partner:innen, die glauben, Salzen wäre das gleiche wie Würzen.