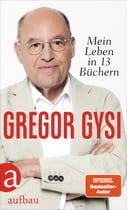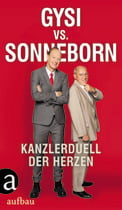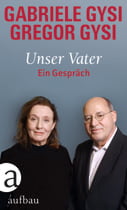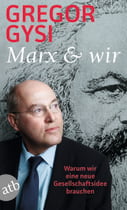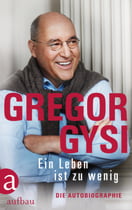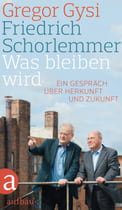Mit Gregor Gysi auf literarischer Erkundungstour
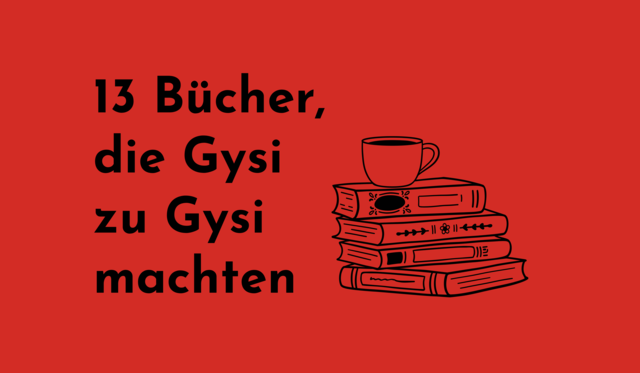
Gregor Gysi stellt 13 Titel vor, die ihn begleitet, berührt oder zum Widerspruch gereizt haben. Persönlich, unterhaltsam und pointiert erzählt er, was Literatur für ihn bedeutet – und warum man beim Lesen nicht auf Listen hören sollte.
Mein Leben in 13 Büchern
Mein Leben in 13 Büchern! Das klingt zunächst so, als hätte ich es beim Lesen von Büchern nur ganz knapp übers Dutzend geschafft. Stimmt natürlich nicht. Es passen viel mehr Buchtitel in mein Leben, und mein Leben ließe sich umgekehrt auch mit weit mehr Büchern beschreiben.
Dabei geht es aber nicht um Lesepflichten. Meines Erachtens sollte man die Menschen nicht mit umfangreichen Listen wie »Die 100 besten Bücher der Welt« oder »Diese Werke der Weltliteratur muss man gelesen haben« einschüchtern. Das nimmt den Spaß am Lesen und Entdecken. Und ich mag den Absolutheitsanspruch daran nicht. Zudem kann man sowieso nicht allen Empfehlungen folgen.
Für mich geht es viel mehr um die Frage, welche Bücher mich besonders berührt haben, was sie mir bedeuteten und bedeuten. Eine Auswahl, mehr nicht! Wie bei jedem anderen Urteil müsste man auch bei Lese-Erlebnissen Ort und Datum beifügen; kein Eindruck ist ja frei von Beeinflussung durch Zeit und Raum.
Natürlich schreibe ich über die ausgewählten Bücher keine Rezensionen, ich interpretiere und bewerte nicht. Ich äußere mich gewissermaßen als Liebhaber. Ich bleibe persönlich.
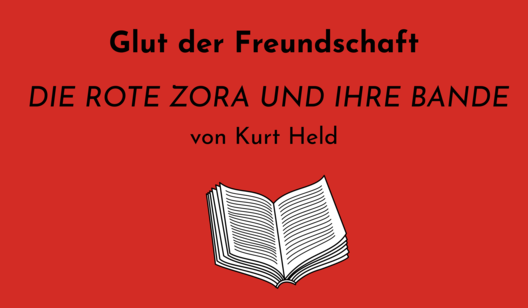
Es war eine schöne Zeit. Es war die Zeit mit dem Papagei, der dem schiffbrüchigen Robinson Crusoe auf der Schulter saß. Es war die Zeit mit Freibeutern und Piraten, und golden glänzten die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht.
Es war die Zeit meiner Kinder- und Jugendbücher, als ich noch seltsamere Berufswünsche hatte als Rinderzüchter, Rechtsanwalt und Politiker, nämlich: Seeräuber, Häuptling, Trapper und Ritter. Oder Bandenmitglied.
Etwa zehn, elf Jahre alt war ich, als ich zum ersten Mal dieses Buch in die Hände bekam, in dem ein 13-jähriges Mädchen zur Bandenchefin und in dieser Rolle von allen Jungs akzeptiert wird. Das fand ich zunächst etwas doof.
Bücher über Banden habe ich grundsätzlich gern gelesen, etwa Erich Kästners Emil und die Detektive, das von den Nazis verboten wurde, und das davon handelt, wie Emil und die Kinderdetektive einen Dieb durch ganz Berlin verfolgen, Indizien sammeln und den Täter schließlich gemeinsam stellen.
In solchen Erzählungen spürte man etwas, das man vielleicht als Glut der Freundschaft bezeichnen könnte. Es interessierte mich, wie von bedingungsloser Solidarität unter widrigsten Bedingungen erzählt wird, von einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, von Wagemut, Begeisterungsfähigkeit und liebevoller Bindung aneinander ...
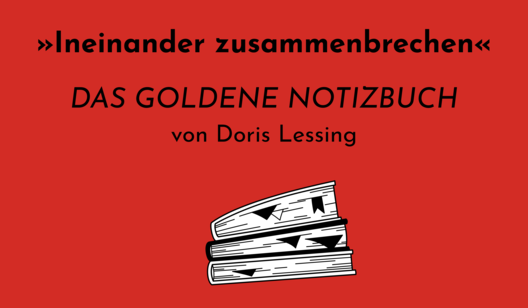
2007 schaffte es folgender Satz von mir in die Nachrichten, obwohl ich nichts vollbracht hatte: »Es ist das Vorrecht von Politikern, auf Dinge stolz zu sein, bei denen ihr Leistungsanteil gleich Null ist. Dieses Vorrecht genieße ich heute auch.« Hier, bei Doris Lessing, lag mein Anteil absolut bei »Null«.
Sie war meine Tante. Eine angeheiratete Tante: 1945 hatte sie Gottfried Lessing, meinen Onkel mütterlicherseits, geheiratet. Die beiden lernten sich in Südrhodesien – der heutigen Republik Simbabwe im Süden Afrikas – kennen, nachdem der jüngere Bruder meiner Mutter Deutschland Anfang 1938 wegen seiner jüdischen Herkunft verlassen hatte.
Nach Herstellung der deutschen Einheit traf ich sie in Hamburg. Sie sprach kein Deutsch und ich nur mäßig Englisch. Vielleicht ein bisschen kühn, aber durchaus überzeugt prophezeite ich ihr damals schon den Literaturnobelpreis. Sie widersprach heftig.
Etwa zwei Wochen später teilte mir mein Pressesprecher mit, meine Tante habe den Literaturnobelpreis erhalten. Ich war natürlich begeistert! Mehrere Journalistinnen und Journalisten hätten angerufen, um mich zu sprechen. Ich bat, ihnen zu erklären, nicht ich, sondern meine Tante in London habe den Preis bekommen. Ja ja, sagte mein Pressesprecher, das wüssten sie, trotzdem …!
Nun ja, ich kaufte Sekt, lud auf der Fraktionsebene des Bundestages zu einem Gläschen ein und erklärte: »Eine Tante als Nobelpreisträgerin – mehr geht nicht, höchstens, wenn man ihn selber bekommt, aber wofür?«
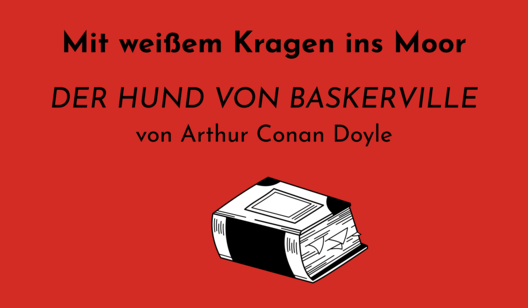
»Und ich rate Euch, vorsichtig zu sein und dem Moor fernzubleiben in jenen finsteren Stunden, da die bösen Mächte ihr Spiel treiben.« Ja, es geht gespenstisch zu in der Grafschaft Devonshire. Tötete jener mysteriöse schwarze Hund, der blutgierig durch die Moor-Gegend geistert, auch Sir Charles Baskerville? Und was sind das für merkwürdige Signale, die das sorgenbeladene Dienerpaar Barrymore von Baskerville Hall ins Dunkel sendet? Wer ist zudem dieser dubiose Naturforscher? Ein geflohener Serienmörder aus dem Zuchthaus Dartmoor treibt in der Gegend sein Unwesen. Und dann, immer wieder, dieser monströse Hund, missbraucht für fehlgeleitete menschliche Leidenschaften und unbezwingliche Erbgier …
Mehr Inhaltsangabe braucht diese Geschichte von Arthur Conan Doyle nicht, immerhin ist sie weltbekannt, gehört zur Klassik des Detektivromans. Und sollte tatsächlich jemand die Lösung dieses Falls noch nicht kennen, will ich ihm das Vergnügen nicht nehmen.
Nur so viel sei verraten: In diesem Buch herrscht, trotz Spannung, eine geradezu trotzige Gemächlichkeit. Keine Action, die hetzend voranjagt, wie man es sonst in unserer Zeit der Reizüberflutung von nervenaufreibenden, brutalen Thrillern gewohnt ist. Beim Lesen ergeht es einem wie beim Schauen älterer Kino- und Fernsehfilme: Man erlebt Entschleunigung. Mitunter wird es fast schon so gemütlich, als sei man selbst zur britischen Teatime eingeladen. Das Artige bildet mit dem Schauder eine fantastische Einheit. Bisweilen möchte man aufs Tempo drücken und kann somit feststellen, wie sehr man doch vom Zeitgeist geprägt ist ...