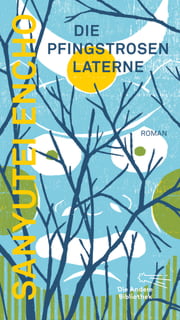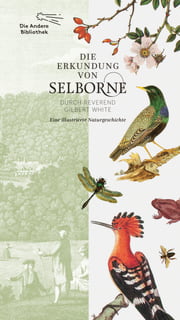»In Dschungeln. In Wüsten. Im Krieg«: Gabriele Riedle im Interview
Die Erzählerin in Ihrem Roman ist eine Reporterin, die schon seit Jahren um die Welt reist, vor allem auch in Krisen und Kriegsgebiete. Diese Erfahrung teilt Sie mit Ihnen, Gabriele Riedle. Haben Sie also so etwas wie eine Autobiographie geschrieben?
Eine Autobiographie hätte ja einen völlig anderen Gestus, weil die Akkuratheit und auch Vollständigkeit dessen, wovon erzählt wird, im Mittelpunkt stehen und sich die Erzählweise dem weitestgehend unterwerfen müsste. Ein Roman funktioniert aber genau umgekehrt. Das ist ein künstlerisch gestaltetes und sehr durchkomponiertes Stück Prosa, bei dem es nicht im Geringsten um mich als reale Person geht, sondern eben um eine Erzählerinnenfigur, die eine bestimmte Welt und eine bestimmte Weltsicht ausbreitet. Meine eigenen Erfahrungen verwende ich dabei lediglich als Material - ebenso wie die Erfahrungen von anderen Leuten, oder wie Elemente aus der Medien-, aus der Film-, aus der Literatur- und aus der Kunstgeschichte, die ich ebenfalls einfließen lasse, natürlich neben sehr vielen rein fiktiven Elementen.

Ich kann zwei Beispiele nennen: Ich wohne in der Goethestraße in Berlin-Charlottenburg ebenso wie die Erzählerin im Roman, und zwar nur deshalb, weil die Goethestraße im Roman zu einem der Punkte der geistesgeschichtlichen Landkarte gerät, von der immer wieder die Rede ist: Da ist Goethe mit seinem west-östlichen Diwan, auf dem die Erzählerin dann angeblich immer liegt, da sind Herder, seine Gedanken zum Verhältnis der Völker und die gleichnamige Straße, die die Goethestraße kreuzt, da sind die Hegelplätze in Stuttgart und Berlin, die für die Aufklärung stehen. Wenn ich in irgendeinem Amselweg oder in einer Bergstraße wohnen würde, wären diese sicher nicht in den Roman eingeflossen. Oder die Sache mit den schmerzenden Knien der Erzählerin. Mir ging es darum, ein Bild für eine alternde Person und gleichzeitig für eine alternde Gesellschaft zu finden. Und da nahm ich eben einfach meine eigenen schmerzenden Knie, die sonst in keiner Weise der Erwähnung wert wären, als Vehikel. Ansonsten gilt natürlich ohnehin nach wie vor: Verwechsle nie die Erzählerin mit der Autorin.
Ihr Roman spielt an sehr vielen, teilweise durchaus abgelegenen Orten dieser Erde, unter anderem in Afghanistan, der Mongolei, im Nordkaukasus, in Libyen, in Liberia, in Papua Neuguinea, in Nigeria, in Tibet, aber auch in New York, Hamburg und Berlin – warum haben Sie sich entschieden, in Ihrer Prosa an all diese Schauplätze zu gehen?
Ich finde es wichtig, dass es auch noch etwas anderes als Dorfromane gibt mit leicht überschaubaren Schauplätzen und begrenztem Personal, denn das birgt ja die Gefahr, der Komplexität der Welt zu entfliehen. Mir jedoch geht es darum, zumindest den Versuch zu unternehmen, diese Komplexität genauer zu betrachten, Absurdes zu schildern, manchmal auch Monströses, so wie unsere Gegenwart eben tatsächlich ist, und auch Verbindungen herzustellen, oft sogar zwischen sowohl räumlich als auch zeitlich weit voneinander entfernten Dingen, die aber eben doch in unterschiedlichster Weise zusammengehören, einander bedingen.
Sie schaffen es oft sogar, in einem einzigen ihrer ja meist sehr langen Sätze einmal um die Welt und auch quer durch die Zeitgeschichte zu gehen.
Das ist sozusagen mein poetisches Verfahren, in langen Sätzen Dinge, von denen man erst einmal nicht auf die Idee kommt, dass sie zusammengehörten, so zu kombinieren, dass in diesem Vexierspiel ganz neue Gedanken und Bilder entstehen. Auch dazu wieder ein Beispiel: Es gibt einen sehr, sehr langen Satz, ich glaube, es ist der längste im Buch, in dem es um den legendären Fernehrreporter Peter Arnett geht, er beginnt in einem Hotel in Afghanistan, führt in den Irak, nach Paris, zur Documenta in Kassel, ins Weiße Haus in Washington, nach Pakistan, wo Bin Laden getötet wurde, nach Neuseeland und dann wieder zurück ins Hotel Afghanistan. Diese erst einmal ziemlich aberwitzig erscheinende Reise durch Zeit und Raum funktioniert aber nur, wenn die Sprache so gestaltet ist, dass sie einen mühelos von Ort zu Ort trägt.
Tatsächlich ist in Rezensionen immer wieder die Rede davon, ihre Sprache sei geradezu rauschhaft, entwickle eine Art Sog. Haben Sie denn auch in einer Art Rausch geschrieben?
Im Gegenteil! Ich finde, es gibt nichts Schwierigeres als etwas zu gestalten, was sich hinterher fast wie ein Musikstück anhört und, so hoffe ich wenigstens, ein wildes sprachliches Vergnügen erzeugt. An manchen langen Sätze habe ich deshalb Wochen gearbeitet. Es kommt da ja auf den Klang jeder einzelnen Silbe an.
Nicht umsonst ist Ihr Roman auch als eine Art Poem bezeichnet worden.
Mir sehr recht. Schon weil das ja die maximale Entfernung zu der Art von Reportage-Realismus kennzeichnet, mit dem sonst der Zustand der Welt beschrieben wird. Wobei sich der Reportage-Journalismus übrigens meist selbst gehörig in die Tasche lügt. Rudolf Augstein hat ja den Satz geprägt: »Sagen, was ist«. Das ist natürlich eine ehrenvolle Einstellung und ich habe auch nichts gegen jede Bemühung ordentlicher Dokumentation. Nur dass das natürlich letztlich unmöglich ist. Jede Dokumentation enthält immer schon Elemente der Fiktion, ob wir das wollen oder nicht. Selbst journalistische Darstellungen unterliegen bestimmten Erzähltraditionen, bestimmten Dramaturgien, Berichte sollen grundsätzlich spannend sein beziehungsweise unterhaltend, das lässt sich nicht vermeiden – man muss sich dessen nur bewusst werden und nicht so tun als sage man eben nur, was ist. Wenn man sich nur vor Augen hält, dass bereits der erste Kriegsbericht der Menschheitsgeschichte, die Ilias, ein Epos, also extrem gestaltet und womöglich ohnehin komplette Fiktion war.
Zum Schluss endlich noch die Frage: Warum bezeichnen Sie Ihr Buch als »eine Art Abenteuerroman«?
Weil das meiste von dem, was die Personen in diesem Buch erleben, letztlich fast klassische Abenteuer sind. Andererseits sind wir nicht mehr im 19. Jahrhundert und ich kann sie nicht mehr so aufschreiben, wie man es damals getan hätte. Im 21. Jahrhundert muss ich diese Erzähltradition vielmehr mitreflektieren, was ich beispielsweise damit tue, dass etwa Karl May oder Joseph Conrad, zwei Meister des Genres, immer wieder bei mir vorkommen. So wird aus dem klassischen Abenteuerroman eben nur noch »eine Art Abenteuerroman«. Wobei ich das Buch übrigens ohnehin lieber eine »Rhapsodie der von allen möglichen Abfallhaufen geklaubten Lumpen« genannt hätte, denn das ist eine ziemlich präzise Zusammenfassung von dem, was ich mache. Dabei handelt es sich um eine Formulierung von Robert Burton in seiner »Anatomie der Melancholie« von 1621, der ich auch das lange Motto im Buch entnommen habe. Aber ich sehe ja ein, dass das ein eher ungenießbarer Untertitel gewesen wäre.